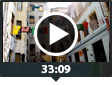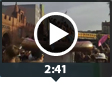Die Bürgerinitiative war ein Kind der 70er Jahre, lange hielt man sie für tot, jetzt ist sie wieder da. In den Kiezen wird mehr debattiert denn je, überall in der Stadt bilden sich basisdemokratische PlattformenFelix Denk (zitty 25/2007)
Carsten Joost hat sie immer in seinem Rucksack: Die Hochglanz-Broschüren der Mediaspree, der Entwicklungsgesellschaft, die Investoren in den Osthafen holen soll. Die Bilder zeigen jene Bürotürme, Lofts und Hotels, die entlang der Spree vom Treptower Park bis zur Jannowitzbrücke gebaut werden sollen. Auf sieben Kilometern sollen Milliarden in Stahl, Glas und Steine investiert werden. Es geht um Grundstücke von zusammen 180 Hektar, das ist viermal die Größe des Potsdamer Platzes. „Diese Flyer sind das beste Argument für unser Anliegen”, sagt Carsten Joost. Denn auf viele Anwohner wirken die Grafiken der geplanten Eingriffe abschreckend. Die Menschen erkennen ihre Kieze kaum wieder. Auf diesen Effekt baut Carsten Joost. Er betreibt eine Bürgerinitiative. Sie heißt: „Mediaspree versenken”.
Es ist Montag. Der 42-jährige Architekt sitzt in einem rosa gestrichenen Zimmer im besetzten Südflügel des Bethanien in Kreuzberg. An den Wänden fordern Plakate „Freiheit für alle politischen Gefangenen” und „G8 verhindern”. Rund 20 Aktivisten von „Mediaspree versenken” kommen zu den wöchentlichen Treffen, die meisten tragen Kapuzenpullis. Carsten Joost kann Erfolge vermelden. Seit dem 2. Oktober läuft das Bürgerbegehren „Spreeufer für alle!”, und schon in den ersten vier Wochen haben 3.600 Anwohner unterschrieben. Die rund 5.400 nötigen Stimmen für einen Bürgerentscheid sind fast beisammen. Dann dürften die Kreuzberger und Friedrichshainer über die Forderungen der Initiative abstimmen: 50 Meter Mindestabstand zum Spreeufer sollen die Neubauten haben und die traditionelle Berliner Traufhöhe von 22 Metern einhalten. Ferner soll keine weitere Autobrücke zwischen Friedrichshain und Kreuzberg gebaut werden. Ein Schild fasst die Forderung der Bürgerinitiative zusammen: „Baut keinen Mist”.
Hier ringt ein Zwerg mit Riesen. Natürlich weiß Joost, dass es schwierig wird, Bebauungspläne und Genehmigungen nachträglich zu ändern. Auch Entschädigungen an Investoren wären fällig – nach Schätzungen des Bezirksamts in dreistelliger Millionenhöhe. Das Engagement der renitenten Kiez-Anwohner mag aussichtslos sein – ein Einzelfall ist es indessen nicht. Im Gegenteil: „Momentan kann man eine Renaissance der Bürgerinitiativen beobachten”, sagt der Soziologe Dieter Rucht vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, der sich intensiv mit den Neuen Sozialen Bewegungen beschäftigt. Ob in der Umwelt- oder Verkehrspolitik, bei Bauvorhaben, der Umbenennung von Straßen oder der Schließung von Schulen – die Berliner wollen wieder mehr mitreden, wenn es um ihre kommunalen Belange geht.
Und ausgerechnet die Bürgerinitiative ist ihre Plattform. In den letzten 20 Jahren galt diese basisdemokratische Aktionsform als mausetot. Ihre Hochphase erlebte sie Anfang der 70er Jahre. Immer, wenn ein Kinderspielplatz von einer Umgehungsstraße bedroht war, begannen besorgte Anwohner, Unterschriften zu sammeln und Sternfahrten mit dem Fahrrad zu organisieren. Nicht immer war das kurzatmiger Pragmatismus. Die Bürgerinitiative Westtangente gründete sich 1974 – und existiert immer noch. Ursprünglich wollte sie den Ausbau der Stadtautobahn durch den Tiergarten verhindern. Das glückte Anfang der 80er Jahre. „Eine Sternstunde”, sagt Matthias Braun, der seit 1992 Mitglied ist. „Bürgerinitiativen waren damals neu. Man konnte auch mal einen Überraschungserfolg landen. Heute ist das schwerer. Projektentwickler und Behörden haben sich auf sie eingestellt.” Nachdem die Westtangente gekippt war, suchte sich die Bürgerinitiative neue Aufgaben. Friedensbewegt widmete sie sich der „Abrüstung im Verkehrsbereich” und entwickelte Ideen und Konzepte für andere Projekte, etwa den Park am Gleisdreieck, der jetzt geplant und gebaut wird. Hier sitzt Matthias Braun mit Vertretern aus Bezirk und Senat zwar an einem Tisch, oft fühlt er sich aber übergangen. „Die Bürgerbeteiligung wird nicht ernst genommen”, sagt er. „Man braucht eine dicke Haut, um eine Bürgerinitiative am Laufen zu halten.”
Doch die scheinen viele zu haben. Die Bürgerinitiative spielt gleich in mehreren Erscheinungsformen wieder eine wichtige Rolle im lokalpolitischen Alltag. Dieter Rucht: „Zum einen gibt es wieder mehr Initiativen, die sich um kommunale Belange kümmern, meistens spontan und aus einem unmittelbaren Anlass gegründet. Zum anderen setzen sich Initiativen für direkte Demokratie ein. Und außerdem boomen Bürgerstiftungen.” Diese kommunal organisierten Initiativen sammeln Geld und bauen damit ein Stiftungsvermögen auf, aus dessen Erträgen Jahr für Jahr dem Gemeinwohl dienende Vorhaben finanziert werden. Besonders aktiv ist die „BürgerStiftung Hamburg”.
Die Ziele der Bürgerinitiativen haben sich seit den 70er Jahren nicht wesentlich verändert, sieht man ab von Initiativen wie „DSL für Pankow” oder der „Interessensgemeinschaft Pankow-Heinersdorfer Bürger”, die ihre Wurzeln – untypischerweise – im rechten Spektrum hat und den Bau der Ahmadiyya-Moschee zu verhindern sucht. Was sie unterscheidet, sagt Dieter Rucht, ist das Repertoire der Mittel. „Inzwischen sind die Leute sehr viel reflektierter, sie gehen strategischer vor und wissen um die Bedeutung von Medien und Kontakten zu Parteien. Sie engagieren sich mit hoher Professionalität.”
Carsten Joost von „Mediaspree versenken” etwa ist initiativenerprobt. Schon in den 90er Jahren engagierte er sich für den Erhalt des Tacheles, später kämpfte er gegen den Abriss des Palasts der Republik. Seit langem ärgert es ihn, wie Investoren den Bezirken ihre Forderungen diktieren und die Bürger zu wenig in die Entscheidungen einbezogen werden. „Das Bürgerinnen-Begehren ist toll für die Stadtplanung”, sagt der Architekt.
Menschen wie Carsten Joost scheinen die oft beklagte Politikverdrossenheit zu konterkarieren. Zwar verlieren Parteien und Gewerkschaften scharenweise Mitglieder und die Wahlbeteiligungen sind nicht nur auf kommunaler Ebene so niedrig wie selten zuvor. Gleichzeitig jedoch steigt die Bereitschaft der Bürger, sich freiwillig zu engagieren – das gilt, wie Umfragen zeigen, für ehrenamtliche Tätigkeiten genau so wie für Bürgerinitiativen.
Die Bürgerlichkeit kehrt zurück. So versteht auch der Soziologe Frank Adloff die Umfragewerte. Besonders die Mittelschicht ist bereit, Verantwortung zu übernehmen. „Vor allem engagieren sich gebildete Männer, die über ein gewisses Einkommen verfügen und religionszugehörig sind.” Bürgerinitiativen von Arbeitern oder Arbeitslosen gibt es nur selten. „Bei einem gemeinschaftlichen Engagement geht es auch um Selbstverwirklichung und Spaß”, sagt Adloff, der zur Zivilgesellschaft forscht.
Schon zu ihrer Hochphase war die Bürgerinitiative eine durchaus bürgerliche Veranstaltung. Dieter Rucht sagt: „Gerade die radikalen Linken haben sie anfangs als interessenborniert und kleinkariert abgelehnt.” Ihr alternatives und aufmüpfiges Image verdankt sie etwa der Bürgerinitiative Umweltschutz Unterelbe, die sich mit Blockaden und Bauplatzbesetzung – letztlich vergeblich – gegen die Errichtung eines Atomkraftwerks in Brokdorf wehrte. Dieter Rucht sieht in der Bürgerinitiative den Ausdruck einer tiefen Parteiskepsis: „Die Parteien werden nicht mehr als allzuständig begriffen. Wenn man den Parteien etwas nicht zutraut, dann muss man das selbst in die Hand nehmen.”
So wie Barbara Schneider. Die 37-Jährige legt sich gerade mit der Evangelischen Kirche an. Blickt sie aus dem Fenster, so sieht sie den Friedhof an der Heinrich-Roller-Straße im Prenzlauer Berg. Nur noch ein Teil wird genutzt. Der Rest ist wild überwuchert. Es ist ein verwunschenes Paradies im eng bebauten Winskiez, den die Anwohner für Spaziergänge und im Sommer schon mal zum Picknicken nutzen. Ob das noch lange so bleibt, ist aber unsicher. Nach dem Willen der Kirche soll ein stillgelegter Abschnitt bebaut werden, die Gemeinde braucht das Geld aus dem Verkauf.
Als die Pläne für eine Bebauung bekannt wurden, hat sich eine Bürgerinitiative für den Erhalt des Friedhofs gebildet. Von Balkonen hängen nun Bettlaken mit holprigen Slogans wie „Totenstille statt Nobelville”. Barbara Schneider rattert die Fakten und Zahlen, die gegen eine Bebauung sprechen bis auf die Kommastelle genau herunter. Umweltschutz, Naherholung, Pietät – all diesen Aspekten würde eine Bebauung nicht gerecht. Dass die Häuser auf dem Friedhof den Blick von ihrem Balkon verstellen würden, räumt sie aber erst auf Nachfrage ein.
Besondere Angst hat die Anwohnerin, dass mit dem Roller-Friedhof ein Präzedenzfall geschaffen wird. Das sorgt auch der Pfarrer Johannes Krug, allerdings unter umgekehrten Vorzeichen. Setzt sich die Bürgerinitiative durch, kann die Kirche den Grund nicht als Bauland verkaufen. Drastische Kürzungen im Gemeindehaushalt wären dann unvermeidlich. Dabei kann der Pfarrer den Ärger der Anwohner durchaus verstehen, er wohnt selbst in der Gegend. Was ihn stört: „Die Bürgerinitiative argumentiert höchst ethisch, legt aber nicht das eigene Interesse als Anwohner offen.” Der Verdacht, aus Egoismus zu handeln, kostet jede Initiative die Glaubwürdigkeit. Soziologen nennen das Problem „Nimby”, die Abkürzung steht für „Not in my Backyard”, nicht in meinem Garten. „Nomgys” – wie in „Not on my graveyard” – wäre wohl die an den Winskiez angepasste Variante.
An politischem Gewicht hat die Bürgerinitiative gewonnen, als 2005 in den Berliner Bezirken das Bürgerbegehren und der Bürgerentscheid eingeführt wurden (siehe Kasten). Schon 20 Mal nutzten die Berliner seither diese Möglichkeit der direkten Mitbestimmung. Nicht alle Initiativen sind erfolgreich verlaufen, etliche sind versandet, ehe sie ihr Anliegen durchsetzen konnten. Aber drei Bürgerentscheide wurden bereits abgehalten, ein weiteres findet Anfang kommenden Jahres in Spandau statt. „Das ist auf alle Fälle ein Erfolg”, sagt Michael Efler vom Verein „Mehr Demokratie”, der das Reformprojekt auf den Weg gebracht hat. Er geht davon aus, dass nach dem Bürgerentscheid in Charlottenburg, bei dem sich 87 Prozent der Wähler unlängst gegen eine Ausweitung der kostenpflichtigen Parkplätze ausgesprochen haben, noch mehr Initiativen kommen werden.
Wie viele, das hängt auch davon ab, wie sich der Bezirk Charlottenburg verhält. Da der Bürgerentscheid denselben Status wie ein Beschluss der Bezirksverordnetenversammlung hat, und darum nicht in jedem Fall rechtlich bindend ist, steht es dem Bezirksamt frei, sich dem Bürgerwillen zu beugen. Bislang haben sich die Bezirke bei Bürgerentscheiden allerdings sehr kooperativ gezeigt, resümiert der Verein Mehr Demokratie. Ganz anders sieht das auf Landesebene aus, wie der ewige Streit um die Schließung des Flughafens Tempelhof zeigt.
Hier betreibt die Interessensgemeinschaft City-Airport Tempelhof (ICAT) aktuell ein Bürger begehren für den Erhalt des Flughafens. Unterstützt wird sie von CDU, FDP und der Wirtschaft. Die SPD dagegen kämpft für die Schließung. Sie vertritt damit die Forderungen der Bürgerinitiative Flughafen Tempelhof (BIFT), die sich schon seit 1986 für eine Schließung engagiert. Während das Volksbegehren ICAT nun läuft, hat der Senat jedoch die Schließung des Flughafens beschlossen. Gegen diese Politik der vollendeten Tatsachen klagt nun die ICAT. Gleichzeitig wächst die Zahl der Unterschriften für den Erhalt von Tempelhof stetig – alleine am letzten Novemberwochenende um 30.000.
Auch Carsten Joost sieht im Bürgerbegehren einen Fortschritt für die Bürgerinitiative: „Wir werden ernster genommen”. Wenn das Bürgerbegehren Erfolg hat und die Friedrichshainer und Kreuzberger zu einem Bürgerentscheid an die Wahlurnen gebeten werden, dürfte die Aufmerksamkeit noch einmal rapide steigen. Und selbst wenn der Entscheid nur empfehlenden Charakter hat und rechtlich nicht verbindlich ist – eine Frage wird deutlich beantwortet werden: Ob die Planungen für das Spreeufer dem Willen der Bürger entsprechen oder nicht. Der Souverän hat das Wort.
|