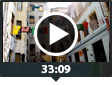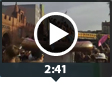"Für wen wird Politik gemacht?"
SOZIALE STADT Die Gruppe Soziale Kämpfe wehrt sich gegen die Gentrifizierung von Kiezen: Diese liege nur im Interesse der Besitzenden, sagt die Sprecherin Toni Garde. Sie fordert Gemeineigentum beim Wohnen
INTERVIEW NINA APIN (taz, 03.03.2010 - Seite 23)
taz:Frau Garde, in einigen Gegenden Berlins ist die Gentrifizierungsspirale am oberen Ende angekommen, in anderen in vollem Gange. Was ist Ihrer Meinung nach die Ursache?
Toni Garde: Diese Entwicklung ist der Logik neoliberaler Stadtpolitik geschuldet. In bestimmte Gegenden und in bestimmte profitversprechende Bereiche der Stadt wird investiert. Andere werden vernachlässigt. Innerstädtische Bezirke gelten derzeit als interessante Wohnlage für Besserverdienende. Hier wird aufgewertet. Es wird sich auf die sogenannte erste Stadt konzentriert. Welche Bereiche dazu gehören, entscheiden nicht die Bewohner, sondern die aktuellen Möglichkeiten der Gewinnsteigerung in einem Gebiet. Die ungleichzeitige Entwicklung ist ein Zeichen des Versagens, besser: des Fehlens jedweder sozialen Stadtpolitik.
Was könnte die Lösung sein: Verstaatlichung von Wohneigentum oder gesetzlich festgelegte Mietobergrenzen?
Beides kann sinnvoll sein. Mietobergrenzen wären ein schnell möglicher erster Schritt. Langfristig müssen wir aus der profitorientierten Wohnungspolitik aussteigen. Nur wenn Wohnen dem Markt entzogen ist, kann es demokratisch kontrolliert werden. Ein zukünftiger sozialer Wohnungsbau darf nicht wie bisher nach Ablauf des Kreditzeitraums wieder an den Markt zurückgegeben werden. Wir brauchen einen breiten kommunalen Wohnungsbestand, der in allen Berliner Bezirken im ausreichenden Maße angemessenen und preiswerten Wohnraum für GeringverdienerInnen zur Verfügung steht. Wir brauchen Gemeineigentum, das von allen gemeinsam besessen, verwaltet und kontrolliert wird.
Wie könnte Wohnen im Gemeineigentum konkret aussehen - wie die bestehenden Wohnungsbaugenossenschaften, etwa in Marzahn?
Die derzeitigen Wohnungsbaugesellschaften sind für uns keine Beispiele für eine sinnvolle Stadtpolitik. Wenn sie aber demokratisch organisiert und kontrolliert wären, gemeinsam besessen und verwaltet würden, wäre das eine Perspektive. Positives Beispiel ist für uns das Freiburger Mietshäusersyndikat, das ja auch in Berlin einige Projekte hat und auf Gemeineigentum setzt.
Wie sehen Sie die Rolle von Baugruppen in der Stadt?
Baugruppen sind für uns keine Lösung, da sie auf Privateigentum aufbauen. Sie sind aber auch nicht unsere Feindbilder. Obwohl es eine Diskussion wert ist, dass auch linke Kultur- und Wohnprojekte oftmals Teil von Gentrifizierungsprozessen werden. Darin spielen sie mit ihrer Fokussierung auf Eigentum eine klassische Rolle. Aber vorrangig geht es um Strukturen einer neoliberalen Stadtentwicklung. Die Konzentration auf den Mittelstand, die Konkurrenzfähigkeit von Stadt und die Hervorhebung von weichen Standortfaktoren ist das Gegenkonzept zu sozialem Wohnungsbau.
Wie kann Verdrängung gestoppt werden?
Zunächst geht es darum, den Zusammenhang zwischen neoliberalem Kapitalismus und einer verfehlten, auf Privatisierung ausgerichteten Stadtpolitik deutlich zu machen. Wir müssen uns dagegen wehren, dass die Kosten der Krise, die aus dem neoliberalen Kapitalismus entstanden sind, den Städten und Kommunen aufgebürdet werden. Das derzeitige Krisenmanagement treibt die sozialen Spaltungen weiter voran: Kommunale Dienstleistungen sind dann nur noch zugänglich für diejenigen, die sie sich leisten können. Die notwendigen Veränderungen in der Politik werden nicht allein durch Appelle und Forderungen zu erreichen sein. Wichtig sind Selbstorganisierungsprozesse und einen gemeinsamen Kampf der verschiedenen sozialen Bewegungen zu organisieren. Denn die Proteste für eine gerechte Bildung, gegen Rassismus, für eine vernünftige Gesundheitspolitik, gegen Investitionsprojekte, die soziale Spaltungen vorantreiben, und für ein Recht auf Stadt gehören zusammen.
Stadtsoziologen sprechen von zivilgesellschaftlichen "Deattraktivierungsstrategien" - was ist das und wie könnte das praktisch aussehen?
Konkrete Deattrativierungsstategien waren ein Teil der Kampagne gegen Gentrifizierungen in Hamburg. Darin werden rassistische und soziale Stereotypen aufgegriffen, die zum Teil in "Broken-windows-Theorien" reproduziert werden. Das war eher ironisch-symbolisch gemeint und ging in die Richtung, Lidl-Tüten und Satellitenschüsseln aus dem Fenster zu hängen und betrunken in Feinripphemden rumzulaufen, um ein bestimmtes Bild von einem Bezirk herzustellen und Investoren und Szenetouristen abzuschrecken.
Welche Widerstandsperspektiven und Gegenmaßnahmen befürwortet die Gruppe Soziale Kämpfe?
Wir wollen die verschiedenen Spektren vernetzen und deutlich machen, dass die Kämpfe um die Stadt mit anderen Kämpfen zusammengehören. Darüber hinaus geht es darum, Selbstorganisierungsprozesse anzustoßen. Das geschieht ja schon vielfach. In Neukölln mit den Kiezversammlungen, in Kreuzberg mit der "SO36 Bleibt!"-Kampagne oder der "
Mediaspree Versenken!-Kampagne, in Friedrichshain bei den Kämpfen um den Erhalt der Hausprojekte. Zurzeit ist hier viel im Gange. Auch die Vernetzung der stadtpolitischen Akteure mit anderen Spektren läuft. Grundsätzlich setzen wir auf ein Recht auf Stadt. Das bedeutet das Recht auf einen Zugang zu einer guten öffentlichen Infrastruktur für alle, die hier leben. Das Recht auf Teilhabe, ein Recht auf Nichtausschluss von städtischen Qualitäten und Leistungen - letztlich wird das nur möglich sein, wenn über die Eigentumsstrukturen gesellschaftlich neu verhandelt wird.
Kann das Anzünden von im Viertel parkenden Luxusautos auch zur erfolgreichen Deattraktivierung beitragen?
Offensichtlich. Wir sind hier aber nicht aktiv.
Ist in manchen Fällen Gewalt gegen Sachen auch akzeptabel, etwa ein Farbbeutelwurf auf Baugruppenprojekte?
Die Frage ist falsch gestellt. Was hat eine Sachbeschädigung - noch dazu eine, die man abwaschen kann - mit Gewalt zu tun? Gewalt ist, wenn Menschen ihre Wohnung und ihre sozialen Bezüge verlieren, weil sie ihre Miete nicht mehr bezahlen können oder weil das Jobcenter die Kosten nicht mehr übernimmt, wenn Menschen aufgrund ihres Aussehens aus dem städtischen Bild zu verschwinden haben, wenn Menschen im Winter erfrieren oder ihren Kindern erklären müssen, dass sie leider nicht mit ihnen ins Schwimmbad können, weil sie das nicht bezahlen können.
Können Quartiersmanagements dazu beitragen, die drohende Spaltung von Arm und Reich in bestimmten Gegenden zu verhindern?
Das Programm ist nicht geeignet, soziale Verwerfungen wie Armut, die aus der übergeordneten gesamtgesellschaftlichen Ebene resultieren, zu bekämpfen. Statt die gesellschaftlichen Ursachen zu beseitigen, wird ein sozial-räumliches Überwachungsinstrument geschaffen, das Workfare, Normalisierung, Kontrolle und Verdrängung für sogenannte soziale Problemgruppen mit sich bringt.
Ist ein gewisses Maß an Belebung und ökonomischer Aufwertung nicht sogar wünschenswert für den Kiez - schließlich bringt das Leben und eine soziale Durchmischung in vorher arme, schlecht entwickelte Gebiete?
Wir haben nichts gegen "Durchmischung", auch wenn das Wort einen etwas merkwürdigen Beiklang hat. Die Frage ist, wer wird von wem durchmischt und nach wessen Interessen und für wen verbessert sich die Lebensqualität. Für die Zugezogenen, für die die Mieten (noch) billig sind, oder für die, für die es teurer wird und die wegziehen müssen - dann wird die Durchmischung schnell zur "Entmischung", wie man etwa an den Absetzbewegungen der weißdeutschen Mittelschicht in die Privatschulen sehen kann. Die Frage ist doch, wer von der "Verbesserung profitiert" und wer an dem neuen Leben partizipiert und partizipieren kann? "Durchmischung" und die nachfolgende Verdrängung funktioniert immer in eine Richtung. Man hört selten von Zehlendorfern, die von Hartz-IV-Empfängern aus ihren Wohnungen verdrängt werden. Es stellt sich doch die grundlegende Frage: Für wen wird hier Politik gemacht? Und wem gehört die Stadt?
"Gewalt ist, wenn Menschen ihre Wohnung und ihre sozialen Bezüge verlieren"